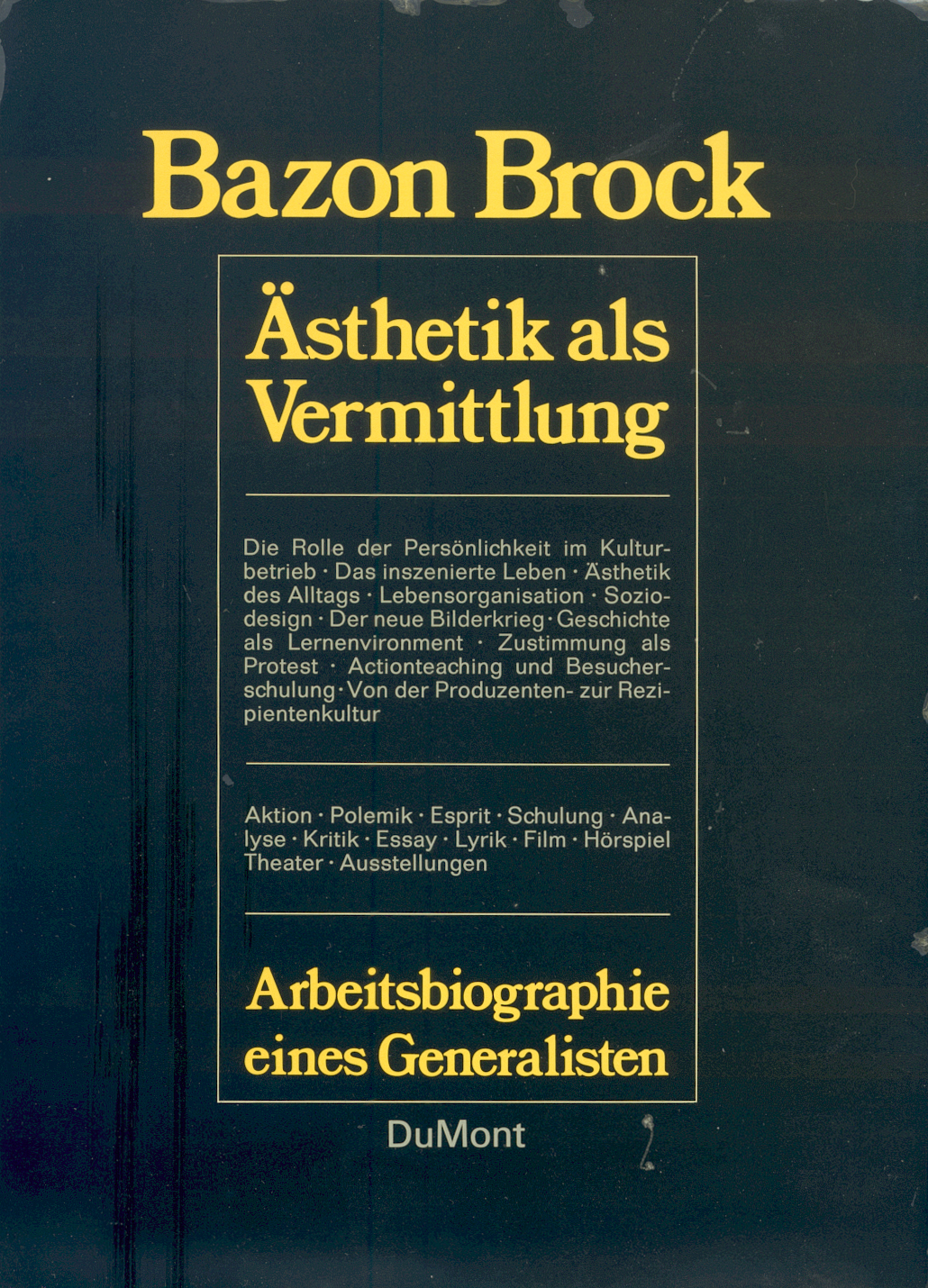Planungsskizze, vorgetragen am 5.12.1973 auf dem Seminar der Architektenkammer, Frankfurt, und der Städelschule zur Friedhofsästhetik.
Mit einigem Grund darf man den Beginn der humanen Zivilisation mit dem Zeitpunkt ansetzen, da eine Gesellschaft ihre Toten nicht mehr als Abfall verscharrt, sondern sie in der Gemeinschaft der Lebenden präsent hält. Der interkulturelle Vergleich lehrt uns, daß tatsächlich das Gegenwärtigbleiben der Toten eine entscheidende Rolle im Zivilisationsprozeß spielt. Wie die einzelnen Gesellschaften diese Vergegenwärtigung leisten, ist erst von sekundärer Bedeutung, obwohl diese Vergegenwärtigungsformen nicht beliebig sind.
Jeder Zivilisationsprozeß entfaltet sich entwicklungsgeschichtlich über die Thematisierung
1 des Machtgedankens (die Herausbildung einer Sozialstruktur);
2 des Todesgedankens (die Herausbildung von Geschichtlichkeit);
3 des Gottesgedankens (die Herausbildung der Struktur des Kosmos);
4 des Heroengedankens (die Herausbildung von Individualität);
5 des Wahrheitsgedankens (die Herausbildung von Gesetzmäßigkeit).
Der Zivilisationsprozeß ist voll entfaltet, sobald eine Gesellschaft im Zusammenleben ihrer Mitglieder diese einzelnen Thematisierungen miteinander in Bezug setzt; sobald also mit Wahrheitsanspruch die Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens im natürlichen Kosmos von den Individuen in deren Lebensäußerungen repräsentiert wird.
Vom Tod kann man immer nur sinnvoll im Hinblick auf die Todeserfahrung der lebenden Individuen sprechen, also nur im Hinblick darauf, wie das Wissen um die Bedingtheit des menschlichen Lebens sich konkret auf die Bewältigung der Lebensanstrengung auswirkt. Die Todeserfahrung der Individuen ist gelungen, wenn sie die Geschichte ihres gegenwärtigen Lebens in der Gesellschaft von Menschen sub specie determinationes sehen können, also die Gegenwart bereits als Teil der Vergangenheit begreifen können.
In unserem Kulturkreis leistete das beispielsweise der griechische Held, der die Grenze zwischen Leben und Tod dadurch aufheben konnte, daß er sich bereits im Diesseits als Toter bestimmte, insofern es ihm möglich war, vorauszuerfahren, wie seine polis seine Taten für die polis als Basis des Überlebens des Toten in der Gesellschaft anerkennen würde. Das leistete für den königlichen Auftraggeber der Künstler, der den noch lebenden König auf seinem Grabmonument bereits als Toten darstellte; und zwar einerseits als verewigten Lebenden, der in alle Zeiten in Gestalt und Habit als König präsent bleibt, und andererseits den Lebenden bereits als würmerzerfressene Leiche vor Augen führt. Den Kern der Vergegenwärtigungsanstrengungen in unserer kulturellen Tradition bildet die Gewichtung der Bedeutung, die dem Gegenwärtigbleiben eines konkreten historischen Individuums einerseits, und dessen Beitrag zur Kultur seiner Gesellschaft andererseits, zugemessen wird. Bislang ist das geschichtliche Überleben der Personen davon abhängig gewesen, wieweit ihre Werke von ihrem Lebensprozeß abspaltbar waren. Zudem hatten diese Werke einen bestimmten Werkcharakter zu haben, wie er im Extremfall dem künstlerischen Werk zugestanden wird. Deshalb konnten alle diejenigen Mitglieder der Gesellschaft nicht überleben, die solche abspaltbaren Werke aufgrund ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen nicht hervorbrachten, obwohl ihr Leben und Arbeiten erst das Fortbestehen der Gesellschaft garantierten. Diesen Gruppen garantierte die Gesellschaft bestenfalls Vergegenwärtigungen in Gestalt des Denkmals des unbekannten Soldaten, des Arbeitertages oder Muttertages. Darüber hinaus blieben diese Gruppen als anonyme Kollektive Gestalten des gesellschaftlichen Unterbewußtseins, die sich in Archetypen künstlerischer und wissenschaftlicher Erzählungen ans Licht brachten. So etwa läßt sich die Erzählung der MARXschen Theorie an vielen Stellen als ein Versuch werten, "dem unbekannten Arbeiter" Vergegenwärtigung in der Gesellschaft der Lebenden zu verschaffen – in überraschender Analogie zum Vorgehen der Erzähler unserer Märchen.
Damit kein unnötiges Mißverständnis konstruiert wird: Es ging und geht bei der Vergegenwärtigung der Toten und ihres Beitrags zum Bestand und der Entwicklung ihrer Gesellschaft immer nur darum, den Tod als Problem der Lebenden zu sehen. Auch für die Christen gilt LUTHERs Verdikt zu diesem Sachverhalt, daß man die Toten ihre Toten begraben lassen solle, obwohl für Christen der Gedanke nahezuliegen scheint, man müsse die Toten als Tote erhalten, damit sie dereinst zum ewigen Leben wiederauferstehen könnten. Die Auferstehung und das ewige Leben können nur von den Lebenden selber garantiert werden, indem sie gegenwärtig halten, was die Toten für das Leben der Lebenden bedeuten, und vor allem, indem sie den Lebenden zeigen, daß es sich lohnt, für die Nach-Lebenden zu arbeiten. Jüngstes Gericht und Auferstehung sind das Leben selber. Die Unsterblichkeit kann aber nicht nur im Überleben der Gattung garantiert werden, sondern muß als Lebensmut und Lebensfähigkeit des Einzelnen erscheinen. Das heißt zugleich, daß nicht erst das Schaffen von Werken die Voraussetzung für die Garantie der Unsterblichkeit des Einzelnen durch die Gesellschaft sein kann, sondern bereits die Tatsache des bestandenen Lebens selber.
Der Verfall unserer Totenkultur ist vor allem darin begründet, daß die Vielzahl der Gesellschaftsmitglieder nicht mehr verstehen kann, daß ihre für den Bestand der Gesellschaft ganz unbestritten bedeutsame Arbeit als Werk nicht bestimmbar ist, und demzufolge ihnen das Leben schon zur ewigen Verdammnis wird, als welches jedes Leben erscheinen muß, das seinen Sinn nicht transzendieren kann, weil es die Garantien des Überlebens unter den Lebenden nicht vorfindet. Selbst die Künstler als in diesem Sinne privilegierte Gruppe sind inzwischen auch mit ihren bedeutendsten Werken von dieser apokalyptischen Todesdrohung erfaßt. Freilich sind weder sie noch die anderen Einzelnen in ihrem Alltag bereit, die Erinnerungsanstrengung und damit die Verewigung der Toten zu leisten. Bestenfalls unterstützen sie Institutionen wie Museen, Theater und Kirchen, die diese Funktion allerdings nur im Hinblick auf die Toten (und nur ansatzweise im Hinblick auf die Lebenden) wahrnehmen. Aber auch diese Bereitschaft nimmt ab, wie beispielsweise die Kirchenaustritte zeigen.
Selbst wenn man die Kirchensteuer in eine Geschichtssteuer umwandeln würde, um den unbedingten säkularen Charakter der Unsterblichkeitsgarantie zu retten, würde damit wenig erreicht sein. Die Toten unter den Lebenden gegenwärtig zu halten, heißt eben nichts anderes, als den Anspruch der Individuen gegen die kollektive Anonymität durchzusetzen; und zwar unabhängig von ihren Werken, allein im Hinblick auf die Tatsache, daß sie und wie sie ihr Leben bestanden.
Der Nutzungswandel der Friedhöfe und die in der herkömmlichen Weise nicht mehr bewältigbare Anzahl von Toten sollte nicht nur dazu führen, neue Friedhofsformen zu finden, die den Gegebenheiten einer Massengesellschaft Rechnung tragen. Vielmehr muß die Totenkultur insgesamt eine neue Funktion gewinnen. Ansätze zu neuen Friedhofsformen wurden beispielsweise so geboten, wie Nanda VIGO sie beschrieb: Als Friedhofshochhäuser inmitten der Metropolen. Die neue Funktion ist mit derlei Entwürfen noch nicht gegeben. Auch Hans HOLLEINs Vorschläge, Hünengräber über Wien anzulegen oder riesige Eisenbahnwaggons als Kultmale und Totenspeicher aufzustellen oder aber die Toten in metallenen Heimgräbern zu konservieren, zielen noch nicht auf einen neuen Umgang der Lebenden mit den Toten. Ebensowenig wie die amerikanischen Gärten der Freiheit, die die Toten in die Natur reintegrieren, wo sie von den Besuchern im Naturgenuß gewürdigt werden können.
Ebensowenig wie meine eigenen Vorschläge, die Untergrundbahnschächte mit Grabkammern auszustatten, um jeden Verkehrsteilnehmer täglich auf einem solchen Gang durch die Unterwelt zur Anstrengung seines Erinnerungsvermögens anzuhalten. Oder aber das gleiche zu erreichen, indem man auf Fußballfeldern oder unter Autobahntrassen die Toten unter sichtbare Grabplatten legt.
Eher schon verweist jener japanische Admiral auf diese Funktion, der schon seit 25 Jahren täglich acht Stunden lang die Namen der unter seinem Kommando gefallenen Soldaten öffentlich repetiert. Auch die Vorstellungen, Bürgerdienste einzuführen, die von Wohnblock zu Wohnblock ein bestimmtes Kontingent an Toten betreuen (indem sie sich gegenseitig der Sozialpflicht unterwerfen, in Rekonstruktionen der toten Leben ihr eigenes Leben auszudehnen) dürfte nur ein Teilaspekt dieser Grundfunktion sein.
Mein Vorschlag wäre, Nandas Totenhochhäuser in den Metropolen zu bauen, aber mit einer zusätzlichen entscheidenden Erweiterung zu versehen. Unter Verwendung der zeitgemäßen Datenverarbeitungsanlagen und der an sie anschließbaren Medien sollte den einzelnen Bürgern Gelegenheit geboten werden, das eigene Leben fortgesetzt zu dokumentieren und zu interpretieren, das heißt, langsam seine eigene Biographie im Hinblick darauf, wie ihn andere sehen sollten, zu entwickeln. Das hätte unter der Voraussetzung zu geschehen, daß diese audiovisuellen Denkmäler von jedermann einsehbar wären und demzufolge auch von jedermann als beispielhafte Vorlagen für die eigene Monumentalisierung genutzt werden können. Die Folge dieser Transzendierung des eigenen Lebens wäre eben die Veränderung der Lebensführung und der Nutzung des Lebens.
Es scheint heute bereits ein deutlich dokumentiertes Interesse an solchen neuen Funktionen der Totenkultur zu bestehen. Darauf verweist unter anderem die Rezeption der Fernsehfilme von Eberhard FECHNER, der beliebige Alltagsbiographien so behandelte, wie man früher Personen des öffentlichen Lebens würdigte.
Eine solche Totenheimat bildete dann tatsächlich ein Kommunikationszentrum, weil es den einzelnen Kommunizierenden erlaubt, sich selbst zum Beispiel zu erhöhen. Durch die elektronischen Medien ließe sich so auch zum erstenmal konkret eine Ahnung von dem Bezugsgeflecht vermitteln, das die sich durchkreuzenden Lebensspuren Einzelner zur Gesellschaft werden lassen. Zudem könnte in dieser Totenheimat wieder eine Vielzahl von Künstlern eine neue Berufsrolle finden, indem sie als Trainer für den Aufbau bzw. die Rekonstruktion und die beispielhafte Nutzung von Biographien sich den ungeübten Bürgern anbieten.
Avant-propos aus der Beschäftigung mit solchen Projekten: 1962 stellte ich bei der Postdirektion Frankfurt den Antrag, einen Telefonanschluß in mein Grab zu verlegen und die Nummer als Zweitnummer zu meinem Namen ins öffentliche Telefonbuch einzutragen. Bis zum fernen Zeitpunkt meiner Nutzung des Grabes sollte ein Anrufbeantworter den Anrufenden versichern, daß ich auch dann – wenn mein Hauptanschluß nicht antworte – noch nicht zu den Abwesenden zu rechnen sei.